Junge Menschen (hier: im Alter zwischen 14 und 27 Jahren) befinden sich in der Lebensphase zwischen Kindheit und Erwachsensein. Anfang und Ende der Jugend sind jedoch nicht eindeutig bestimmbar und Übergänge fließend: Viele Entwicklungsprozesse und -aufgaben sind mit der Volljährigkeit noch nicht abgeschlossen und reichen bis ins junge Erwachsenenalter hinein. Jugend ist also zunehmend entgrenzt.
Zugleich steht jungen Menschen meist kein verlängerter Schonraum zur Verfügung. Sie müssen neben der körperlichen und psychosozialen Entwicklung eine intensive und verdichtete Bildungsphase, den Wandel von Arbeitsverhältnissen, mögliche Arbeitslosigkeit im Jugendalter oder auch Mobilitätsanforderungen bewältigen. Zudem gilt es für junge Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind, diese zu überwinden. Junge Geflüchtete sind darüber hinaus vor weitere Herausforderungen gestellt wie eigene Migrationsprozesse zu bearbeiten.
Mit dem Begriff „disconnected youth“ werden junge Menschen beschrieben, die sich in problematischen Lebenslagen befinden und die weitgehend aus institutionellen Kontexten herausgefallen sind. D. h. sie befinden sich weder in Schule und Ausbildung noch in Erwerbsarbeit und nehmen keine finanzielle Unterstützung wie Bürgergeld in Anspruch.
„Careleaver“ stammt aus dem Englischen und heißt wortwörtlich übersetzt „Fürsorge-Verlasser“. Care Leaver*innen sind junge Menschen, die in stationären Erziehungshilfen im Sinne der §§ 33 und 34 SGB VIII (‚Vollzeitpflege‘ und ‚Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform‘) leben und sich im Übergang in ein eigenständiges Leben befinden oder bereits nicht mehr im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden. Bereits die Planung und Vorbereitung auf den Auszug in eine eigene Wohnung oder in eine andere stationäre Betreuungsform, zählen zu dem Prozess des ‚Leaving Care‘, aber auch die Zeit nach dem Verlassen der stationären Hilfen. Für die meisten jungen Menschen bildet dieser Wechsel aus der 24-Stunden-Betreuung in ein eigenverantwortliches Leben einen herausfordernden biografischen, rechtlichen und sozialen Umbruch, der neben zahlreichen strukturellen Benachteiligungen häufig auch soziale Existenzgefährdungen nach sich zieht. Dieser Übergang ist mit vielfältigen Herausforderungen verbunden, die Careleaver*innen im Gegensatz zu Gleichaltrigen bewältigen müssen.
Wohnen ist ein Grundrecht! Wohnen heißt dabei mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Im UN-Sozialpakt werden sieben Kriterien genannt, die angemessenes Wohnen ausmachen: die rechtliche Absicherung des Raums durch einen Vertrag, die Verfügbarkeit von Trinkwasser und Energie, Bezahlbarkeit, diskriminierungsfreier Zugang zu Wohnraum, Bewohnbarkeit der Räume, kulturelle Angemessenheit und ein geeigneter Standort. Für junge Volljährige ist es oftmals schwierig angemessenen Wohnraum zu finden. Öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind gefordert, neue Wege zu gehen, um ihrer sozialpolitischen Verantwortung gerecht zu werden und das Recht junger Menschen auf Wohnen zu verwirklichen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, um ihnen den Übergang in ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. (vgl. § 1 SGB VIII)
Die Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen bedeutet, ein selbstbestimmtes Interagieren in der sozialen Teilhabe in unterschiedlichen Lebensbereichen wie Bildung, Arbeit, Wohnen oder Freizeit zu ermöglichen und zu fördern. Diese zentrale Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe hat insbesondere durch die UN-Kinderrechte neue Impulse erhalten.
Gemäß § 41 SGB VIII erhalten junge Volljährige geeignete und notwendige Hilfen, wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet. Die Kinder- und Jugendhilfe muss demnach Hilfen für junge Erwachsene anbieten, die eine diskriminierungsfreie und selbstbestimmte Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglichen. Es ist also bei Beendigung einer Hilfe für junge Volljährige genau zu prüfen, ob damit die weitere Persönlichkeitsentwicklung nicht gefährdet wird.
Mindestens bis zum 21. Lebensjahr haben junge Menschen Anspruch auf Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII). In begründeten Einzelfällen ist die Kinder- und Jugendhilfe auch für junge Erwachsene über den 21. Geburtstag hinaus, längsten allerdings bis zum vollendeten 27. Lebensjahr zuständig. „Ein begründeter Einzelfall liegt vor, wenn es aufgrund der individuellen Situation nicht sinnvoll ist, die Hilfe mit dem 21. Lebensjahr zu beenden. Das kann z.B. gelten, wenn mit Vollendung des 21. Lebensjahrs eine schulische oder berufliche Ausbildung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, .. Maßnahmen schulischer oder beruflicher Art, aber auch sozialpädagogischer bzw. therapeutischer Art noch nicht beendet sind“ (Tammen 2022, § 41 Rz 9).
Für das zuständige Jugendamt besteht die Verpflichtung mit anderen öffentlichen Stellen (Sozialleistungs- und Rehabilitationsträger) zusammenzuarbeiten – dies gilt auch für den Übergang von jungen Volljährigen aus der Kinder- und Jugendhilfe in die Wohnungsnotfallhilfen, der aber nur im äußersten Ausnahmefall erfolgen soll. Ombudsstellen für die Kinder- und Jugendhilfe (§ 4a SGB VIII) unterstützen jungen Menschen bei der Durchsetzung ihrer Rechte, falls diese nicht gewährt oder verletzt werden.[1]
[1] Münder, J./Meysen, T./Trenczek, T. (2022): Frankfurter Kommentar SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe. 9. Aufl. Baden-Baden: Nomos
Programmziel ist es, durch passgenaue Angebote die individuelle Handlungskompetenz der jungen Menschen, aber auch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Sozialrechtskreise zu stärken. Bestehende Lücken zwischen den verschiedenen Rechtskreisen – vor allem der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), der Arbeitsförderung (SGB III), der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), der Sozialhilfe (SGB XII) und der Eingliederungshilfe (SGB IX) – sollen dabei reduziert und vor Ort eine rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit auf- und ausgebaut werden. Dabei sollen insbesondere die neuen Regelungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes zum Zuständigkeitsübergang auf andere Sozialleistungsträger (§ 41 Absatz 3 in Verbindung mit § 36b SGB VIII) sowie die sog. „Coming-Back-Option“ (§ 41 Absatz 1 Satz 3 SGB VIII) und die Regelungen zur Nachbetreuung (§ 41a SGB VIII) flankiert werden. In vielen Unterstützungsbereichen der jungen Menschen gibt es Berührungspunkte zwischen den Aufgaben dieser Rechtskreise und deshalb besteht eine besondere Notwendigkeit einer guten Kooperation in den Kommunen und einer guten Gestaltung der Schnittstellen.
Als soziale Integration wird die Aufgabe sämtlicher gesellschaftlicher Kräfte beschrieben, allen jungen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, das individuelle Recht auf Teilhabe an den gesellschaftlichen Bereichen soziale Sicherheit, Bildung, Arbeit, Gesundheit und Kultur zu verwirklichen, Entwicklungen der Gesellschaft mit zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Alle jungen Menschen haben das Recht auf eine diskriminierungsfreie Teilhabe in allen Lebensbereichen unserer Gesellschaft.[1]
Die Kinder- und Jugendhilfe hat den Auftrag, über all ihre Handlungsfelder hinweg die Teilhabe und Integration von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in die Gesellschaft zu unterstützen. Um junge Menschen bedarfsgerecht zu erreichen, ist es erforderlich, ihre Verhaltensweisen, Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und dabei ihre Begegnungs- und Erfahrungswelten sowie ihre Sprachen, Werte und Kommunikationsmuster nachzuvollziehen.
[1] Vgl. Werkbuch Leaving Care, S. 50ff
Am Übergang von der Schule in Ausbildung und Arbeit sehen die Sozialgesetzbücher II, III, VIII und IX für junge Menschen eine Vielzahl von Instrumenten und Angeboten vor, weshalb sich die Suche nach der passenden Unterstützung für junge Menschen mitunter schwierig gestaltet und nicht selten zu Überforderung führt. In vielen Kommunen gibt es bereits Jugendberufsagenturen, als rechtskreisübergreifende Kooperationsbündnisse von Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Jugendämtern und anderen beteiligten sozialen Akteuren, um ihre Leistungen gebündelt anzubieten. Ziele der Zusammenarbeit sind die bedarfsorientierte und passgenaue Beratung, Begleitung und Unterstützung junger Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf möglichst „wie aus einer Hand“, um individuelle Lösungen für junge Menschen zu ermöglichen.
Junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren sind die Altersgruppe, deren Armutsgefährdungsquote mit 25,5% von allen Altersgruppen (1,55 Millionen junge Menschen) 2021 am höchsten lag (Destatis 2023): Mehr als jede*r vierte junge Erwachsene gilt damit als armutsgefährdet (Funcke/Menne 2023). Junge Erwachsene befinden sich vielfach noch in Ausbildung (Schule, Berufsausbildung oder Studium), so dass hier neben dem SGB II-Bezug auch andere Sozialleistungen, wie BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe oder Wohngeld, greifen. Die hohe Armutsbetroffenheit junger Erwachsener insgesamt weist darauf hin, dass das Zusammenwirken der verschiedenen Systeme nicht zu einer Existenzsicherung dieser Altersgruppe führt.
Das Programm JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit möchte junge Menschen vor Ort mit konkreten Angeboten unterstützen. Dabei sind die Unterstützungsleistungen in die jeweiligen lokalen Strukturen eingebettet. Für jeden jungen Menschen soll so ein passendes Angebot vermittelt werden. Gemeinsam mit dem jungen Menschen ermitteln die sozialpädagogische Fachkräfte den individuellen Unterstützungsbedarf, erarbeiten Zukunftsperspektiven und unterstützen bedarfsgerecht bei der Umsetzung.
Trotz unterschiedlicher Hilfsmaßnahmen, die das SGB VIII vorsieht, haben die Erfahrungen aus den vergangenen Förderperioden des Europäischen Sozialfonds gezeigt, dass in den Kommunen in Deutschland (sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum) nach wie vor ein Bedarf an Angeboten zur Unterstützung junger Menschen an der Schwelle zur Selbständigkeit besteht.
Die Programmziele werden durch vier methodische Bausteine mit Projekten in den Kommunen umgesetzt. In allen methodischen Bausteinen kommt die sozialpädagogische Einzelfallhilfe zum Einsatz.
Die Projekte beinhalten auch einen ganzheitlichen Betreuungsansatz bei der sozialen Integration, insbesondere mit Blick auf den Übergang in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie beim Thema Wohnen.
Ein niedrigschwelliger Zugang wird durch aufsuchende Jugendsozialarbeit, Gruppenangebote und die voraussetzungslose Teilnahme sichergestellt.
Der Baustein „Aufsuchende Jugendsozialarbeit“ ist eine Form der sozialpädagogischen Fallarbeit für junge Menschen, die alleine nicht den Weg zu Unterstützungsangeboten finden. Sie werden in ihrer Wohnung oder an den Orten, an denen sie sich gewöhnlich aufhalten (zum Beispiel Jugendclubs, Plätze „zum Abhängen“, in Notunterkünften oder auf der Straße) von sozialpädagogischen Fachkräften, wie beispielsweise Streetworker*innen oder mobilen Berater*innen, aufgesucht.
Aufgabe der Fachkräfte ist es, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen anzusprechen, Vertrauen zu ihnen aufzubauen und sie an entsprechende Unterstützungsangebote (Dienste, Personen und Einrichtungen) heranzuführen. Dies können auch digitale und soziale Medien (zum Beispiel Internetportale speziell für die Zielgruppen, Messengerdienste sowie einschlägige Apps oder Chat-Gruppen) sein, um mögliche Hemmschwellen auf Seiten der jungen Menschen abzubauen.
Bei Bedarf erfolgt im Rahmen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit zum Zwecke der gezielten und nachhaltigen Begleitung und Beratung eine Weitervermittlung der jungen Menschen an das Case Management (Baustein 3).
Der Baustein „Niedrigschwellige Beratung/Clearing“ umfasst kurzfristig angelegte, individuelle sozialpädagogische Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen. Diese werden durch eine Beratungs- oder Clearingstelle erbracht, die für junge Menschen als „erste Anlaufstelle“ dienen soll. Hier wird der jeweilige weitere Unterstützungsbedarf geklärt und bei Bedarf an die zuständigen Institutionen bzw. Ansprechpartner*innen (zum Beispiel therapeutische Beratungsstellen, Drogen- und Suchtberatungsstellen, Wohnungsämter, Agenturen für Arbeit und Jobcenter) weitervermittelt.
Einfache Unterstützungsleistungen, wie beispielsweise kurzfristige Beratungen und Hilfe bei der Wohnungsbewerbung, können von der Beratungs- oder Clearingstelle selbst erbracht werden.
Jugendliche und junge Erwachsene mit intensiverem Unterstützungsbedarf werden an spezialisierte Hilfsangebote oder in das längerfristig angelegte Case Management übergeben (Baustein 3).
Der Baustein „Case Management“ beinhaltet eine intensive und langfristig angelegte individuelle sozialpädagogische Begleitung der jungen Menschen über bestimmte Lebens- und Entwicklungsabschnitte sowie über einzelne Rechtskreise und Unterstützungsangebote hinweg. Der Prozess des Case Management umfasst die Ermittlung von Ausgangs- und Bedarfslagen, die Planung und Koordinierung der erforderlichen Hilfen sowie deren Erfolgskontrolle und kann auch eine Unterstützung hin zu stabilen Wohnverhältnissen (zum Beispiel Hilfe bei der Wohnungssuche oder Begleitung bei Wohnungsbesichtigungen) beinhalten.
Wesentlicher Bestandteil der individuellen Förderplanung ist zunächst, die Ausgangs- und/oder Problemlage der Jugendlichen und jungen Menschen sowie ihren konkreten Hilfebedarf zu ermitteln und ein individuelles Kompetenz- und Bedarfsprofil zu erstellen. Im Case Management wird im Verlauf des Begleitungsprozesses regelmäßig geprüft, ob die vereinbarten Ziele erreicht wurden, die gewählten Hilfen weiterhin geeignet und notwendig sind oder eine Anpassung des Förderplans erforderlich ist. Werden im Rahmen der Umsetzung der Hilfen andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind diese an der Erstellung des Förderplans und dessen Überprüfung zu beteiligen.
Sofern spezialisierte Hilfsangebote wohnortnah vorhanden sind – zum Beispiel Schuldner-, Sucht- und Drogenberatungsstellen, Jobcenter, Agenturen für Arbeit sowie Dienste und Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe – vermitteln und begleiten Case Manager*innen die jungen Menschen bei Bedarf dorthin und koordinieren die Inanspruchnahme der Hilfen für sie. Konkrete Hilfsmaßnahmen neben der sozialpädagogischen Begleitung bieten die Case Manager*innen nur dann selbst an, wenn sie hierfür besonders geeignet sind – z. B. wenn bereits eine enge Vertrauensbeziehung besteht.
Mit der „Erprobung neuer Wohnformen“, soll die Schaffung verschiedener (in der jeweiligen Kommune noch nicht vorhandener) Wohnformen für junge Menschen und deren Unterbringung in das jeweilige Wohnprojekt modellhaft erprobt werden. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden im Rahmen der Umsetzung von Baustein 4 individuell sozialpädagogisch begleitet. Wie eng und lange die Begleitung erfolgt, hängt vom individuellen Bedarf des jungen Menschen ab. Die Begleitung dient auch dazu, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Verselbständigung zu unterstützen.
Zur Schaffung gesicherter Wohnverhältnisse für junge Menschen kommen beispielsweise folgende Unterbringungsformen in Betracht: Das betreute Einzelwohnen, Wohngemeinschaften, intensivpädagogische Wohngruppen, Jugendwohnheime, aber auch die Rückkehr in familiäre Wohnverhältnisse.
Wohnen ist ein Grundrecht! Wohnen heißt dabei mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Im UN-Sozialpakt werden sieben Kriterien genannt, die angemessenes Wohnen ausmachen: die rechtliche Absicherung des Raums durch einen Vertrag, die Verfügbarkeit von Trinkwasser und Energie, Bezahlbarkeit, diskriminierungsfreier Zugang zu Wohnraum, Bewohnbarkeit der Räume, kulturelle Angemessenheit und ein geeigneter Standort. Für junge Volljährige ist es oftmals schwierig angemessenen Wohnraum zu finden. Öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind gefordert neue Wege zu gehen, um ihrer sozialpolitischen Verantwortung gerecht zu werden: das Recht der jungen Menschen auf Wohnen zu verwirklichen und ihnen den Übergang in ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Im Rahmen der marktwirtschaftlich organisierten Wohnungsversorgung in Deutschland wird Wohnraum als Immobilie verstanden. Immobilien werden als Investition oder Anlageobjekt angesehen und Wertsteigerungen erwartet. Wohnen ist dann Mittel zum Zweck, um investiertes Geld zu vermehren. Von den meisten Eigentümer*innen werden Möglichkeiten wie Mieterhöhungen bei Neuvermietung genutzt, um diesen Zweck zu verwirklichen. Da eine umfassende und effektive politische Regulierung bislang ausbleibt, fehlen deutschlandweit günstige Wohnungen und Sozialwohnungen – insbesondere in den Ballungszentren. Dabei sind städtische Kontexte für viele junge Menschen besonders geeignete Wohnorte aufgrund der Nähe zu Ausbildungsplätzen oder Hochschulen. Auch weitere soziale Infrastrukturen, die für junge Menschen wichtig sind, sind meist in städtischen Kontexten zu finden. Durch die Angebotsknappheit sind Mieter*innen in einer Konkurrenzsituation. Menschen mit höheren Einkommen und weiteren Privilegien werden in der Regel von Vermietenden bevorzugt. Junge Menschen in prekären Lebenslagen wiederum haben meist mangelnde Ressourcen sozialer, aber auch finanzieller Art: Careleaver*innen können bspw. oftmals nicht auf finanzielle Rücklagen für Mietkautionen zurückgreifen oder eine Bürgschaft bekommen. Vermieter*innen begegnen ihnen teils mit Vorurteilen. Careleaver*innen werden somit häufig bei der Wohnungssuche diskriminiert und haben ungleiche Chancen auf dem sowieso schon angespannten Wohnungsmarkt.
Wohnformen junger Erwachsener sind vielfältig. Einige wohnen allein in einer eigenen Wohnung (Singlewohnen), andere in Wohngemeinschaften mit Menschen ähnlichen Alters oder in Wohnprojekten mit mehreren Generationen. Bezogen auf junge Menschen, die sich in einem Wohnungsnotstand befinden, werden in der Jugendsozialarbeit aktuell Wohnkonzepte wie Housing first erprobt. Housing first ist ein US-amerikanischer sozialpolitischer Ansatz. Die Grundidee ist, Wohnungslosigkeit unmittelbar zu beenden und direkten Zugang zu Wohnraum zu verschaffen. Menschen erhalten bei Housing first einen eigenen Mietvertrag, ohne Vorbedingungen erfüllen zu müssen. Außerdem werden begleitend und zeitlich flexibel individuell passende soziale Hilfen angeboten – aber nur, wenn die Mieter*innen dies wünschen. Weitere, kontinuierlich begleitete Wohnformen sind das ambulant betreute Wohnen und das Wohnen in betreuten Wohngemeinschaften, bei denen Fachkräfte die jungen Menschen im Alltag unterstützen. Diese „BeWos“ können auch themenbezogen ausgerichtet sein, so gibt es unter anderem gender- und kulturspezifische Angebote.
Careleaver*innen müssen im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen oftmals früh auf eigenen Beinen stehen und verfügen gleichzeitig über geringere materielle und soziale Ressourcen. Dies erschwert den Zugang zum Wohnungsmarkt. Pädagogische Angebote wie „Wohnführerscheine“ sollen hier gegensteuern, jungen Menschen Zugänge zum Wohnungsmarkt erleichtern und ihnen Hinweise geben, wie ein langfristiges, gutes Mietverhältnis gestaltet werden kann. Deutlich wird aber mit Blick auf Wohnungsnotlagen von Careleaver*innen, dass pädagogische Begleitprogramme nicht genügen, solange die Zugangschancen zu Wohnraum ungleich verteilt sind. Öffentliche und freie Träger tragen hier eine Verantwortung, Wohnungsnotstand im jungen Erwachsenenalter zu begegnen. Viele öffentliche Träger haben selbst Zugang zu Wohnraum, die meisten Kommunen sind an Wohnungsgenossenschaften beteiligt und/oder verfügen über Immobilien. Auch viele freie und konfessionelle Träger haben selbst Immobilien oder Kontakte zu Eigentümer*innen. Es gilt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, zu erhalten und privilegierte Zugänge für junge Menschen aus den Hilfen zur Erziehung zum Wohnungsmarkt zu ermöglichen.
Wohnkrisen entstehen häufig im Zusammenhang mit biografischen Umbruchsituationen, etwa bei Trennungen, bei einem Verlust der Lehrstelle, des Studien- oder Arbeitsplatzes oder auch bei Wohnortswechseln. In der Folge können verschiedene Formen von Wohnungslosigkeit entstehen: Neben der offenkundigen Wohnungslosigkeit von jungen Menschen, die auf der Straße leben, gibt es auch sogenannte „verdeckte“ Formen von Wohnungslosigkeit wie das Übernachten in Notunterkünften und in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe oder auch das Schlafen bei Bekannten oder Freund*innen („Sofa Hopping“). Kommunale Notunterkünfte und andere Institutionen der Wohnungslosenhilfe werden von jungen Erwachsenen in der Regel so lange wie möglich vermieden, da sie von ihnen meist als unpassend erlebt werden. Der soziale Nahraum wiederum wird als Möglichkeit gesehen, ein Leben auf der Straße zu umgehen. Oftmals handelt es sich auch um Pendelbewegungen: die jungen Menschen wechseln zwischen den verschiedenen Formen von Wohnungslosigkeit. Meist werden Wohnnotlagen junger Menschen eher beiläufig bekannt, etwa im Zuge von Gesprächen zur Berufsvorbereitung.
Bis zum Erreichen der Volljährigkeit ist die Jugendhilfe dafür zuständig, dass das Recht junger Menschen auf Wohnen verwirklicht wird. Mindestens bis zum 21. Lebensjahr haben junge Menschen Anspruch auf Hilfen nach dem SGB VIII. In Ausnahmen ist die Jugendhilfe auch für junge Erwachsene zwischen 21 und 26 Jahren zuständig (diese Verlängerung des Anspruchs greift bspw. oftmals bei queeren jungen Erwachsenen). Die Wohnungslosenhilfe wiederum greift in der Regel ab 21 Jahren, wird teils aber auch schon für Personen ab 18 Jahren gewährt. Außerdem besteht für das zuständige Jugendamt die Verpflichtung mit anderen öffentlichen Stellen (Sozialleistungs- und Rehabilitationsträger) zusammenzuarbeiten – dies gilt auch für den Übergang von jungen Volljährigen aus der Jugendhilfe in die Wohnungsnotfallhilfen, der aber nur im Notfall erfolgen soll.
Wohnraum ist eine zentrale Voraussetzung für soziale und gesellschaftliche Teilhabe. Er dient als Schutzraum, ermöglicht eine grundgesetzlich geschützte Privatsphäre und ist ein Ort, an dem junge Menschen sich individuell entfalten und Eigenständigkeit erproben können. Für Careleaver*innen, also junge Menschen, die in Pflegefamilien, Wohngruppen oder anderen betreuten Wohnformen aufgewachsen sind, gibt es größere Herausforderungen als für andere junge Menschen, ihr Recht auf Wohnen zu verwirklichen. Mit der Novellierung des SGB VIII durch das KJSG besteht ein gesetzlicher Auftrag für die öffentlichen und freien Jugendhilfeträger, besonderen Herausforderungen und Risiken in den Lebenslagen von Careleaver*innen, die zu Wohnungslosigkeit führen können, zu begegnen und Unterstützungsangebote für junge Volljährige zu schaffen.
Das deutsche Hilfesystem zeichnet sich durch eine „versäulte“ Struktur aus: Die komplexen Lebenslagen und vielfältigen Bedarfe junger Menschen werden im Hilfesystem verschiedenen Fachbereichen zugeordnet und die Zuständigkeiten fallen in unterschiedliche Sozialrechtskreise. Fachliche Zugänge und Kulturen von Institutionen und Akteur*innen differieren, was eine Zusammenarbeit erschweren kann. Hierdurch entstehen Parallelstrukturen, Lücken in der Versorgung und oftmals auch ein wechselseitiges Zuweisen von Verantwortlichkeiten. Um die Bedarfe junger Menschen angemessen zu adressieren, ihnen Verfahrenssicherheit zu geben und den Anspruch auf eine lückenlose Unterstützung zu verwirklichen, sind Kooperationen und Netzwerkbildungen rechtskreisübergreifend erforderlich. Institutionen müssen die Bereitschaft haben, offen zu sein für andere Herangehensweisen und neue Perspektiven. Eine solche koordinierte Zusammenarbeit ist auch integraler Bestandteil des gesetzlichen Auftrags. Einzelne Sozialgesetzbücher geben Kooperationen vor. Darüber hinaus sind seit dem Inkrafttreten des KJSG die Jugendämter verpflichtet, das koordinierte Zusammenwirken von Akteur*innen unterschiedlicher Rechtskreise sicherzustellen.
Die Kinder- und Jugendhilfe hat gemäß § 1 Abs. 1 SGB VIII den Auftrag, junge Menschen so zu unterstützen, dass sie sich in allen Lebensbereichen selbstbestimmt und eigenverantwortlich entwickeln können und gleichberechtigt an Gesellschaft teilhaben. Soziale Teilhabe junger Menschen sicherzustellen, bedeutet auch, dass Akteur*innen aus verschiedenen Rechtskreisen zusammenarbeiten müssen und eine „kommunale Verantwortungsgemeinschaft“ bilden. Handlungsleitend sollen dabei das Wohl junger Menschen und ihre Rechte sein.
Um die soziale Teilhabe junger Menschen zu verwirklichen, sind viele verschiedene Rechtskreise verantwortlich. Das kommunale Jugendamt trägt zunächst die Hauptverantwortung. In der Jugend und beim Übergang ins Erwachsenenleben können je nach individueller Bedarfslage verschiedene weitere Unterstützungsangebote aus Rechtskreisen wie dem SGB II, III, VIII, IX, XII oder dem BGB relevant werden: dazu zählen unter anderem die Jugend- und Schulsozialarbeit, die Eingliederungshilfen, die Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, die Gesetzliche Betreuung, die Berufsorientierung und Berufseinstiegbegleitung, das Jobcenter in den Bereichen Arbeitsmarkt und Integration oder auch Ämter für BAföG.
Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit umfasst drei Ebenen: Auf einer individuellen Ebene werden Fragen zu einem anonymisierten Einzelfall oder einer typischen Fallkonstellation von Mitgliedern verschiedener Rechtskreise besprochen und weitere Schritte abgestimmt. Zweitens spielt die organisationale Ebene eine Rolle, auf der Konzepte und Verfahrensweisen innerhalb einer Institution oder Abteilung zur rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit entwickelt werden. Drittens ist die strukturelle Ebene von Bedeutung, auf der bspw. eine rechtskreisübergreifende Kooperationsvereinbarung zwischen unterschiedlichen Akteur*innen, etwa zwischen Sozialleistungsträgern und freien oder gemeinnützigen Trägern, getroffen wird. Ziel solcher Kooperationsvereinbarungen ist es, die Zusammenarbeit zu fördern und langfristig abzusichern.
Zu den Anforderungen an eine rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit gehört es, die verschiedenen relevanten Ebenen (individuell, organisational und strukturell) zu berücksichtigen und sie immer wieder neu aufeinander abzustimmen. Zweitens ist die Beteiligung junger Menschen über die verschiedenen Rechtskreise hinweg sicherzustellen und dabei eine alters- und entwicklungsentsprechende sowie individuell passende Beteiligungsform zu finden. Ein dritter wichtiger Aspekt ist die Einbettung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit in eine integrative Sozial- und Jugendhilfeplanung: vonnöten ist eine Kopplung mit infrastrukturellen Handlungsebenen, auf denen die angemessene Versorgung von jungen Menschen mit sozialen Unterstützungs- und Förderungsangeboten geplant und umgesetzt wird.
Wenn verschiedene Institutionen zusammenarbeiten und dabei Informationen austauschen, müssen datenschutzrechtliche Bestimmungen beachtet und Persönlichkeitsrechte gewahrt werden. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bedeutet, dass bei einer Weitergabe persönlicher Daten an andere Akteur*innen oder Institutionen zwingend die Zustimmung des jungen Menschen und/oder von Sorgeberechtigten benötigt wird. Wenn in einer rechtskreisübergreifenden Fallbesprechung bspw. personenbezogene Daten benannt werden, so ist hierfür eine Einwilligungserklärung des jungen Menschen erforderlich. In der Praxis handelt es sich jedoch meist um anonymisierte Fallbesprechungen, sodass eine Einwilligung nicht notwendig ist. Zwischen Behörden ist ein Datenaustausch problemlos möglich, wenn die Daten in einer Weise anonymisiert werden, dass kein Rückschluss auf die konkrete Person möglich ist.
Der Übergang von der Schule in den Beruf ist für Jugendliche und junge Erwachsene oftmals ein herausfordernder Prozess – insbesondere dann, wenn es kaum oder keine Unterstützung durch das Elternhaus oder andere Bezugspersonen gibt. Damit junge Menschen an diesem wichtigen biographischen Punkt angemessene Unterstützung erhalten, gibt es in vielen Regionen Jugendberufsagenturen. Dies sind keine neugeschaffenen Institutionen, sondern multiprofessionelle Kooperationsbündnisse, in denen die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe zusammenarbeiten. Regional unterscheiden sich die Jugendberufsagenturen teils stark, da sich dem Bündnis häufig weitere Institutionen anschließen und die Unterstützungsangebote auf diese Weise an die ortsbezogenen Bedarfe von jungen Menschen angepasst werden.


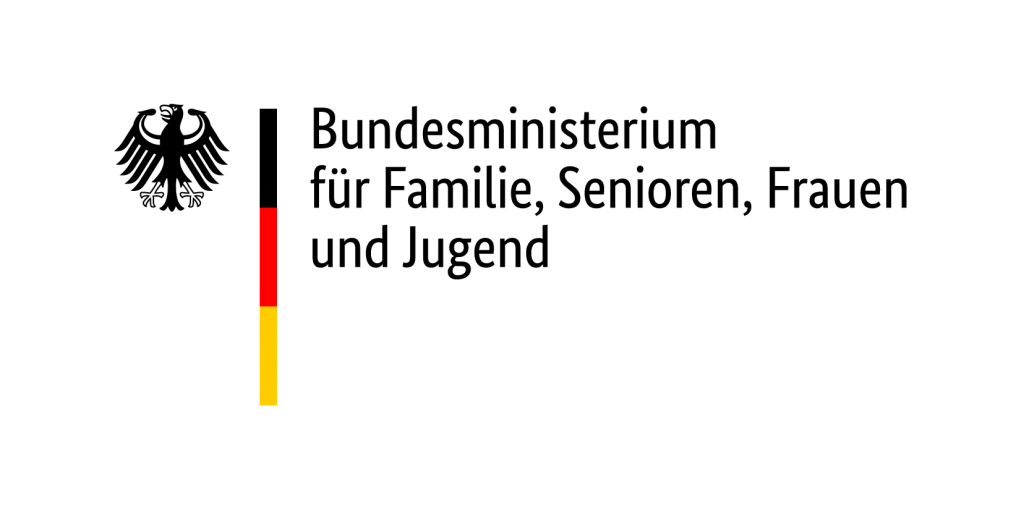

Derzeit befindet sich unsere Website noch im Aufbau. Daher sind viele Inhalte noch nicht abrufbar. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter und erfahren Sie per E-Mail von sämtlichen Neuigkeiten rund um das Beratungsforum JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit.